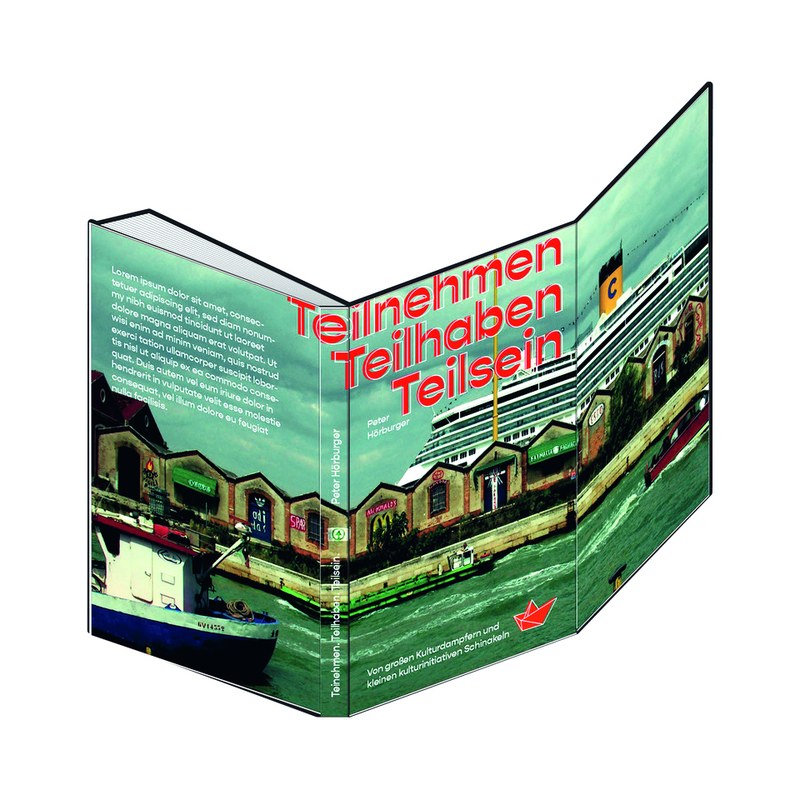„Teilnehmen. Teilhaben. Teilsein. Von großen Kulturdampfern und kleinen kulturinitiativen Schinakeln“
Ist „Kultur“ elitäre Schöngeisterei? Weshalb interessieren sich sehr viele Menschen überhaupt nicht für „Kultur“? Wo fängt „Kultur“ an und wo hört sie auf? Und wer bestimmt das? Diese grundlegenden Fragen werden im neuen Buch „Teilnehmen. Teilhaben. Teilsein. Von großen Kulturdampfern und kleinen kulturinitiativen Schinakeln“ von Peter Hörburger aufgeworfen.
Peter Hörburger ist hierzulande vielen bekannt als ehemaliger Leiter des Spielboden Dornbirn. Manche kennen ihn vielleicht auch noch als einen der Organisatoren des damaligen Freakwave Festivals in Bregenz. Seit 1995 ist er in zahlreichen unabhängigen Kulturinitiativen tätig. Wer ihn ein bisschen kennt, weiß, dass Erstarrung seines nicht ist. Er ist ein lebendiger, umtriebiger Geist, der jederzeit bereit ist alles – auch sich selbst – zu hinterfragen. Wo andere durch gute Positionen vielleicht gerne in gemütlichen, saturierten Arbeitstrott verfallen, überrascht er durch eigenwillige Entscheidungen. So beispielsweise, als er nach vier guten Jahren seine Leitungsposition am Spielboden zurücklegt und wieder nach Wien zieht, sich eine Auszeit nimmt, wieder studiert und neue Projekte vorantreibt.
Sein Studium an der Universität für angewandte Kunst in Wien hat er in der Zwischenzeit auch dazu genutzt, seine eigenen Erfahrungen und Beobachtungen in der Kulturwelt Österreichs zu durchleuchten. Die Ergebnisse dazu liegen nun zusammengefasst als Buch vor und bieten weitreichend Diskussionsstoff – insbesondere für sämtliche Akteure der Kulturszene.
Wachsendes kulturelles Angebot, stagnierendes Publikum
Das kulturelle Angebot ist heutzutage größer denn je. Das Publikum scheint aber nicht mit dem Angebot mitgewachsen zu sein. Immer mehr Anbieter kämpfen um ein kaum wachsendes Publikum, und das obwohl mittlerweile längst alle „Kulturvermittlung“ im großen Stil betreiben. Woher kommt diese Schieflage?
Öffentliche Förderungen für Reiche
Hörburger analysiert den Istzustand der Kulturszene Österreichs ausgehend von der Forderung nach einem „Bürgerrecht Kultur“. „Kultur für alle“ heißt das Schlagwort dafür seit den 1970er Jahren. Die Idee dahinter ist, dass Kultur oft nur sehr elitäre Kreise anspricht, während große Teile der Menschen davon ausgeschlossen sind. Das Stammpublikum klassischer Kultureinrichtungen sind meist hochgebildete und gut situierte Teile der Bevölkerung. Genau diese Kultureinrichtungen bekommen den größten Teil der öffentlichen Kulturförderungen. „Die klassischen Kultureinrichtungen schlucken durchwegs mehr oder weniger genauso viel an öffentlichen Kulturförderungen wie vor 40 Jahren“, schreibt Hörburger und verweist polemisch auf den einzigen Unterschied zu damals, dass die „Kulturbudgetentscheiderinnen“ dabei vielleicht „nicht ganz so begeistert oder mitunter auch mit einem schlechteren Gewissen durchschnittlich 90 % des Kulturbudgets in die großen Kultur- und Kunsthäuser hineinstecken.“
Den großen Institutionen gelinge es nach wie vor kaum, wirklich neues Publikum – im Speziellen Jugendliche und Migranten – nachhaltig anzusprechen, so Hörburger. Die Steigerung der Besucherzahlen bedeute oft nur, dass das gleiche Klientel öfter angesprochen werde, selten aber neue Menschen erreicht würden.
Null Verteilungsgerechtigkeit
Seit den 1970er Jahren habe sich also in Sachen Verteilungsgerechtigkeit nicht sehr viel getan in Österreichs Kulturpolitik. Nach wie vor gebe es einen klaren Zusammenhang zwischen Bildung, Sozialstatus und kultureller Beteiligung. Durch die Ausgrenzung bestimmter Menschengruppen werde jedoch auch eine große Chance auf das Zusammenführen der Gesellschaft verpasst. Außerdem werde sich der elitäre Kulturbetrieb so auf lange Sicht selbst zerstören, wenn es nicht geschafft werde, neues, auch jüngeres Publikum anzusprechen.
Kultur über den Kulturbetrieb hinaus
Demgegenüber stellt Hörburger Kulturinitiativen der sogenannten „freien Szene“. Sie ermöglichen kulturelle Teilhabe oft sehr niederschwellig, haben einen breiten kulturellen Zugang, sind näher dran an den Menschen und ermöglichen flexibel „Kultur über den Kulturbetrieb hinaus“, schreibt Hörburger. Partizipation sollte dabei nicht nur „bloßes mitmachen“ bedeuten, sondern komplette Mitbestimmung – angefangen bei der Art der Teilnahme, über die Bedingungen des Mitmachens, bis hin zur Themensetzung. Statt „Kultur für alle“ müsste es heute richtigerweise „Kultur mit, von und durch alle“ heißen. Nach wie vor erhalten Kulturinitiativen jedoch einen minimalen Anteil der öffentlichen Kulturförderungen.
Große Kulturdampfer und kleine kulturinitiative Schinakel
Hörburger zeigt Methoden zur Stärkung kultureller Teilhabe auf. Insbesondere im Hinblick auf Diversität und die Einbindung neuer sozialer Gruppen. Was Kulturinitiativen aus der freien Szene seit jeher organisch tun, versuchen große Kulturhäuser oft zu imitieren, doch ihnen fehle es an der notwendigen Authentizität. Die Lösung laute Kooperation statt Konkurrenz. Die großen Häuser sollten sich wirklich öffnen und neue Verbindungen zu freien und frischen Kulturinitiativen finden. Dabei gehe es um ausgeglichenes Geben und Nehmen. Eine aktivierende Kulturpolitik sollte kooperative Ansätze ermöglichen und koordinieren.
How to change?
Für ernstgemeinten Wandel sieht Hörburger auf drei Ebenen radikalen Handlungsbedarf.
Einerseits muss die Kulturpolitik eine Umverteilung nach unten einleiten. Die Verteilung muss sich gerechterweise an der Wahrheit der Bevölkerungsaufteilung orientieren, wenn die Kulturlandschaft zukunftsorientiert, glaubwürdig und frei sein soll. „Die Ungleichverteilung ist nicht nur ausgereizt, sondern grenzwertig und ermangelt jeder sozialen und demokratischen Rechtfertigung.“ Öffentliche Kulturbudgets müssen nach einem durchdachten, sozial ausgeglichenen gesellschaftlichen Schlüssel aufgeteilt werden.
Gleichzeitig dürfen Kulturinitiativen nicht passiv auf Gerechtigkeit warten. Auch sie haben Gestaltungsmacht. Die gesammelte Kraft von unten und von der Seite müsse stärker werden. Dazu gehöre auch, dass man sich selbst hinterfragt und wenn nötig verändert. Also „check your privilege“: Wie sieht die Haltung, die Diversität des Personals, die Programmierung und die Kommunikation in der eigenen Kulturinitiative aus?
Und drittens gelte für alle Menschen: Mach mit. Nimm teil. Sei dabei. Sonst verändere sich nie etwas.
Peter Hörburgers Buch ist eine wissenschaftliche Abhandlung und daher keine leichte Lektüre für den Abend. Er zeigt anhand vieler Beispiele aus der Praxis, wie ein theoretischer Weg in die Zukunft aussehen könnte. Seine Polemik ist oft erheiternd, die dargelegten Erkenntnisse in ihrer Klarheit teilweise frustrierend. Handlungsbedarf ist an vielen Enden und Ecken gegeben. Das gilt über die Kulturwelt hinaus auch gesamtgesellschaftlich.
Peter Hörburger, Teilnehmen. Teilhaben. Teilsein. Von großen Kulturdampfern und kleinen kulturinitiativen Schinakeln, Bucher Verlag, Hohenems 2020, 176 Seiten, Softcover, ISBN 978-3-99018-521-6, € 23