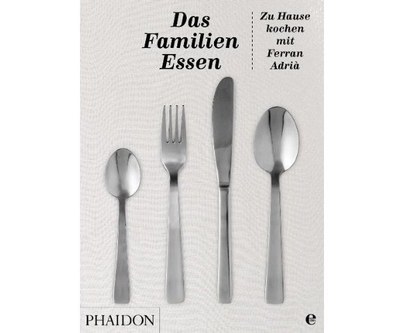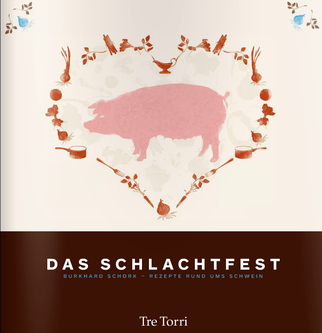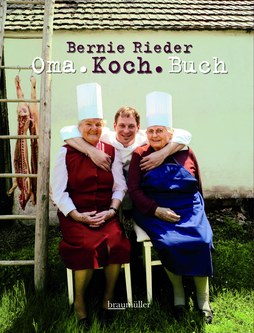Neues für das Kochbuchregal
In den letzten Jahren ist es dank Amazon üblich geworden, Bücher von neuen oder wenig bekannten Autoren mit dem Sprüchlein „für die Leser von XY“ zu empfehlen. Auf den Umschlag von Juan Morenos Teufelsköche (Piper) würde ich „für die Leser von Anthony Bourdain“ schreiben.
Der Titel lässt ja vielleicht eher an Jörg Zippricks lesenswerte Generalabrechnung mit der Gastronomie „In Teufels Küche“ (Eichborn) denken, in der es gegen Gourmet-Führer, Molekularküche, Jürgen Dollase, Fernsehköche und Nahrungsmittelindustrie ging, aber Morenos Buch mit dem Untertitel „An den heißesten Herden der Welt“ porträtiert 17 Köche, die in den Gourmetzeitschriften und im Fressfeuilleton selten bis gar nicht vorkommen (mit zwei Ausnahmen: Vincent Klink und Juan Amador), obwohl – oder weil – sie besonders farbige Charaktere sind.
Dazu gehören die ehemaligen Küchenchefs von Idi Amin und Erich Honecker, die spanischen Stierschwanz-Monopolisten Mari Carmen Rodriguez und Toribio Anta, der aus Ägypten stammende Illegale Rashid (ein Pseudonym), der in Amsterdam nicht nur Haschischkekse bäckt, sondern auch harte Drogen unters Essen mischt, der verurteilte Vergewaltiger Brian Price, der die Henkersmahlzeiten für 200 texanische Todeskandidaten zubereitete, Faith Muthoni mit ihrem „Restaurant“ auf der größten Müllkippe von Nairobi, und Frank Pellegrino, in dessen Lokal „Rao’s“ seit Jahrzehnten alle Tische an New Yorker Prominente vergeben sind, und der wegen seiner Standardantwort auf Reservierungsanfragen „Frankie No“ genannt wird, obwohl es Ausnahmen gibt: „Doch, ich nehme auch kurzfristige Reservierungen an – für amtierende Präsidenten oder den Papst – oder höher gestellte Persönlichkeiten.“ Das Buch enthält 17 Rezepte, eines zu jedem Porträt (Fotos: Mirco Taliercio), unter ihnen eines für Fufu: „Maniokmehl mit kaltem Wasser anrühren, mit Salz und Pfeffer abschmecken. Langsam erhitzen und bei mittlerer Hitze ständig mit einem Holzlöffel umrühren, bis die Masse eine püreeartige Konsistenz annimmt. Mengenangaben je nachdem, wieviel Hunger man hat.“
Ein Teufelskoch fehlt in diesem Reigen, der von Kim Jong-il, von dem man weiß, dass er auf Einkaufstouren in europäische Luxus-Delikatessenläden geschickt wurde, während die koreanische Regierung dem Volk Rezepte für Gräser und Baumrinde verlautbarte.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Auch das neue Buch des Ehepaars Martina Meuth und Bernd Neuner-Duttenhofer Auf der Suche nach dem verlorenen Geschmack (Lübbe) ist kein „richtiges“ Kochbuch. Es enthält zwar 30 Rezepte, aber eigentlich ist es eine alphabetisch geordnete Warenkunde. Denn nicht die beiden Publizisten haben ihren Geschmacksinn eingebüßt, sondern manche Lebensmittel ihren Eigengeschmack. Vieles wird ständig dubioser, wenn man es nicht kenntnisreich auszusuchen weiß, sondern im nächsten Supermarkt halt einkauft, was zu Großmutters Zeiten zwar vielleicht noch gleich hieß, aber in manchen Fällen etwas anderes war, als es heute ist. Das könnte man zum Beispiel vom Joghurt-Marmeladen-Mix „Fru-Fru“ im Vergleich mit einem heutigen Fruchtjoghurt sagen; damals kannte man weder „probiotische“ Bakterienstämme noch „naturidentische“ Aromen. In dem Buch ist natürlich vieles auf deutsche Verhältnisse abgestimmt, zum Beispiel ein Kasten über „Das Deutsche Qualitätssiegel“: „Welche Qualitätsprofile die Produkte dafür erfüllen müssen? Keine. Die gesetzlichen Mindestanforderungen genügen! Die deutschen Lebensmittelproduzenten haben es nämlich geschafft, den Gesetzgeber dazu zu bringen, bereits für die mindeste Qualität, die überhaupt in Verkehr gebracht werden darf, ein Gütesiegel zu vergeben!“ Solches lässt sich auf EU-Verhältnisse übertragen: Was in dem Buch über Schinken „Schwarzwälder Art“ zu lesen ist, dass er etwas ganz anderes als „Schwarzwälder Schinken“ ist – „nämlich mit Tannenraucharoma behandeltes Pökelfleisch“, gilt auch für alle anderen Schinken irgendeiner „Art“, lesen Sie doch mal genauer, was auf dem Schildchen Ihres Supermarkt-„Parmaschinkens“ steht!
Besonders interessant ist die Auseinandersetzung des Journalistenehepaars mit dem, was „Merum“-Chefredakteur Andreas März seit Jahren über Olivenöl schreibt, denn sie können sich „seiner Rigorosität nicht immer uneingeschränkt anschließen“. Das ist gut, denn so verdienstvoll März’ Kampf für gutes Olivenöl ist (er behauptete immer, 99 Prozent unserer Supermarkt-Öle seien indiskutabel), dürfte doch sein Reinheitsgebot für Olivenöl tatsächlich etwas übertrieben sein. Vor allem stoßen sich Meuth und Neuner-Duttenhofer an der auch von März propagierten Veronelli-Methode, das Öl aus entsteinten Früchten zu pressen, weil sie ihrer Meinung nach dem Öl seinen Charakter nimmt. März war der erste und radikalste, der darauf hinwies, dass das Prädikat „extra vergine“ jede Bedeutung verloren hat, die beiden beschreiben nun die Gewinnung von Olivenöl durch Raffination mittels Hitze und Säuren aus oft schon verschimmelten Pressrückständen, das völlig legal unter der Bezeichnung „reines Olivenöl“ verkauft werden darf. „,Reines Olivenöl’ ist also ein Produkt der Lebensmittelindustrie, das von den Big Players der großen internationalen Olivenöl-Branche in rauen Mengen angeboten wird. Gerne auch in edlen Inhalt verheißenden Blechkanistern, die hübsch bunt und/oder nostalgisch, mit traditionellen Motiven geschmückt sind und mit längst nicht mehr aussagekräftigen Medaillen von Weltausstellungen, die vor mehr als hundert Jahren stattfanden ... und damit die gute alte Zeit beschwören.“
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Bernie Rieder, früher einer der bekanntesten „Jungen Wilden“ Österreichs, hat nicht nur bei Köchen wie Gerer und Witzigmann gelernt, sondern zunächst einmal bei seinen beiden Großmüttern, der Juzzi Oma und der Steffi Oma. In seinem Oma.Koch.Buch (Braumüller, 29,90 Euro) hat er ihnen ein Denkmal gesetzt und stellt eine erkleckliche Anzahl der Rezepte in zwei Varianten ins Buch, zum Beispiel „Omas Kalbsrahmgulasch“ und auf der nächsten Seite „Bernies Kalbsrahmgulasch mit Limettenblättern, Chili und Pinienkernen“. Da die Texte recht ausführlich gehalten sind, kann man auch noch bei den bekannten Rezepten alla nonna nützliche Informationen finden. Rieders Varianten unterscheiden sich in vielen Fällen nur durch eine andere Würzung. Für die Sammler von Kochbüchern zur österreichischen Küche ist das Buch Pflicht, es kann aber auch jedem empfohlen werden, der Einbrennsuppe, Krautfleckerln oder Grenadiermarsch ein bisschen abwandeln und dabei auf die Erfahrungen eines Profikochs zurückgreifen möchte.
Manchmal schießt der Texter des Buches („Initiator und Textkonzeption Claus Schönhöfer“ steht auf dem Innentitel) übers Ziel hinaus, zum Beispiel, wenn man unter „Kochtipps und Begriffe“ den Hinweis liest: „Wann ist das Rohr vorgeheizt? Bei jedem Herd mit Elektrobackrohr, den ich kenne, gibt es ein Lamperl (Lämpchen) – meistens rot, aber manchmal auch blau oder grün. Das erlischt, sobald die gewünschte Temperatur erreicht ist.“ Fehlen für die Adressaten solcher Tipps nicht die Ratschläge, heiße Herdplatten nicht anzufassen oder die Plastikverpackung der TK-Pizza vor dem Backen zu entfernen? Daneben ist auch ein langes Gejammer auf Seite 116 über die Grausamkeit der Thunfisch-Mattanza im Mittelmeer. Daneben, weil schon seit Jahren keine mehr stattfindet – nicht aus tierschützerischen Gründen, sondern weil die Japaner die Thunfische schon vor der Meerenge von Gibraltar wegfischen lassen, sodass die Mattanza mangels Masse eingestellt werden musste.
Übrigens ist Bernie Rieder am 7. Juli 2007 in Bregenz nicht nur koch- sondern auch sonst künstlerisch in Erscheinung getreten, nämlich mit seinem „Sautanz 2007“ in Paul Renners „Theatrum anatomicum“ beim Kunsthaus: „Vor mir hing ein bereits gesäubertes Schwein, das auf seine Verarbeitung wartete. Unter mir – quasi als Showeinlage – lag ein menschlicher Glaskörper. Ich hatte die Idee, einen Menschen aus Schweineteilen nachzubauen. (...) Im Laufe des Abends zerlegte ich nach und nach das gesamte Schwein und schlichtete die übrigen Organe sowie alle Fleischteile in den Glaskörper. Für die Gäste stand gleichzeitig ein zu jedem Organ und jedem Fleischstück passender Gang bereit. Als krönenden Abschluss hackte ich dem Schwein den Kopf ab und setzte ihn dem Glaskörper auf. Fertig war mein Schweine-Mensch!“
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Stellen Sie sich ein großformatiges Buch vor, in dem die Rezepte mit doppelseitigen Farbfotoserien illustriert sind. Beispielsweise sieht man für eine Brotsuppe mit Knoblauch folgende, selbstverständlich auch noch recht ausführlich betexteten Bilder: drei ganz normale Brotscheiben in einer ganz normalen Bratpfanne – das gebräunte Brot – mit dem Messer zerdrückte Knoblauchzehen – Knoblauch mit Öl in der Bratpfanne – ein Löffel voll Paprikapulver über dem Knoblauch – ein Schöpfer voll Hühnerbrühe über dem mittlerweile zugegebenen Brot – Finger, die Salz in die Pfanne streuen – Brotscheiben in der Brühe – ein Stabmixer, der die Suppe püriert – die pürierte Suppe – ein (extra) pochiertes Ei wird in die Suppe gegeben. Mal ehrlich: Brächten Sie diese Brotsuppe mit Ei ohne die 11 Fotos zusammen? Ja, doch? Ich auch. Wahrscheinlich jeder. Aber ich will nicht tricksen: Es gibt auch kompliziertere Rezepte in dem Buch, zum Beispiel das für Lammnacken mit Senf und Minze oder jenes für das mexikanische Hähnchen.
Es werden 31 Drei-Gänge-Menüs vorgestellt, wie Kartoffelsalat, Thai-Curry mit Rind und Erdbeeren mit Rotweinessig, oder Melone mit Schinken, Reis mit Ente und Schokoladentörtchen. Man sieht, dass es sich um eher einfaches Essen handelt. Also ein Kochbuch für Anfänger, die es nicht so mit dem Lesen haben? Ist doch gut, dass es so etwas gibt! Oder nicht? Das Buch heißt Das Familienessen (Edel Germany) und ist 2011 als „The Family Meal“ in London erschienen. Die Pointe daran ist die, dass es sich um ein Kochbuch aus dem „elBulli“ handelt, dem Restaurant von Ferran Adrià, das bis zur Schließung am 30. Juni 2011 von der Gourmetpresse als „das beste Restaurant der Welt“ bezeichnet wurde. Im „elBulli“ wurden den Gästen viele kleine Gänge vorwiegend kulinarischer Bizarrerien vorgesetzt. Als „Familienessen“ bezeichnete man in diesem Restaurant das gemeinsame Essen der 75 Mitarbeiter, das eingenommen wurde, bevor für die Abendgäste geöffnet wurde.
Dabei aßen Adrià selbst, die Chefköche und ihre Assistenten als Vorspeisen Farfalle mit Pesto, gratinierte Polenta oder Waldorfsalat, als Hauptgang Cheeseburger, Kabeljau-Sandwich oder Schweinerückensteaks, und als Dessert Ananas mit Sirup, Reispudding oder Schokoladenmousse. Im Vorwort heißt es dazu: „Viele sind überrascht, wenn sie erfahren, dass wir hier ganz normales Essen zu uns nehmen. (...) Auch unsere Mitarbeiter haben ihr Lieblingsessen: Eigentlich unterscheiden wir Restaurantprofis uns darin nicht sonderlich von den anderen. Beispielsweise nahmen sich die meisten Mitarbeiter öfter von frischer Pasta nach als von allen anderen Gerichten (...). Unter den Hauptgerichten stehen besonders Hamburger hoch im Kurs.“ Wirklich überrascht sind wir ja nicht davon, dass auch die Belegschaft vom „elBulli“ lieber Pasta und Risotto als Tomaten-Sphären, Gemüse-Gelatin-Streifen mit Holzkohlenöl und lyophilisiertes Obst aßen, und auch nicht davon, dass sie das frank und frei zugeben, sondern dass diese Tatsache in einem Buch mit dem Aufkleber „Einfache Gerichte zum Nachkochen aus dem legendären elBulli Restaurant“ ausführlich breitgetreten wird. Der eine oder andere Gast, der im „elBulli“ für 230 Euro dreißig kleine Kuriositäten gegessen hat, wird sich nun denken: „Verdammt, ich hätte doch auch viel lieber das Menü Nr. 9 – Adlerfisch mit Limette, Osso buco alla Milanese und Piña Colada – gehabt!“
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Zuletzt ein Blick auf eines jener Bücher, um die ich normalerweise einen weiten Bogen mache, nämlich Couchtable-Books mit ganzseitigen Food-Fotografien, deren Nutzen ich nicht einsehen kann. Das Schlachtfest von Burkhard Schörk (Tre Torri) ist so ein Buch, groß, schwer und zum Beispiel auf Seite 182 mit einem 28 x 27 cm großen Foto von einem Teller Spanferkelsülze oder auf Seite 194 mit dem von Verhackertem auf einem Brett – beide sehen genau so aus, wie man das immer schon gekannt hat. Warum ich das nicht gerade billige Buch doch gekauft habe? Ein paar Rezepttitel können Auskunft geben: Gebräunter Milzleberkäs mit „Glotzauge“, geschnetzelte Nierle in zwiebeliger Geiztraubensahne, gesottenes Kuheuter mit Kaplilien-Sahne-Sauce, Maultaschensalat mit Bockbierdressing, gerösteten Landjägern und Brätklößchen, klassische Metzelbrühe mit Leberknödeln, mit Markkruste überbackener Schlachtbraten mit dreierlei gefüllten Markknochen, Solver – Salzfleisch von Knöchle, Maske, Backen, Schwanz und Schälripple, Weißleberröschen gebacken auf Rahmlauch.
Haben Sie schon ein Kochbuch, in dem sich ein Rezept für Weißleber befindet? Weißleber ist die Bauchspeicheldrüse des Schweins, wer sie nicht auftreiben kann, nimmt stattdessen Schweinsbries, eine Drüse muss es für dieses Rezept schon sein. Die meisten Rezepte sind für die Schweineschlachtung, bei einigen sind auch Alternativen angegeben, und im Abschnitt „13 vergessene Schlachtgerichte“ gibt es Rezepte für Rindfleisch und für nicht-schweinische Innereien wie „Oeuf de Boeuf – Stierhodenpiccata mit lauwarmem Kartoffelsalat“. In Bayern isst man so etwas ja noch, aber in den anderen deutschen Bundesländern löst man mit solchen Vorlieben großes Befremden aus.