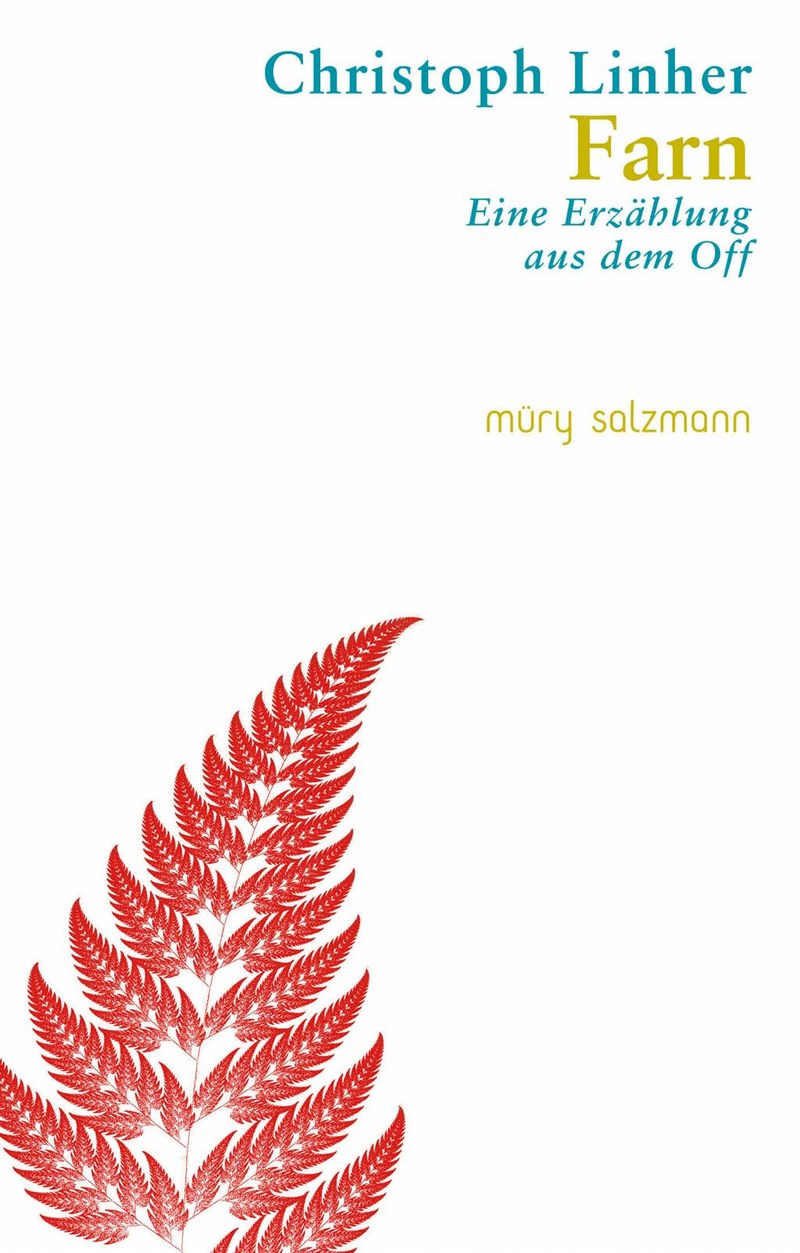Der Konjunktiv als einzig mögliche Wirklichkeitsform - Christoph Linhers bemerkenswertes literarisches Debüt „Farn“
Vor einem Jahr ist der 1983 in Bludenz geborene Schriftsteller, Texter und Musiker Christoph Linher für einen Auszug aus „Farn“ mit dem Literaturpreis des Landes ausgezeichnet worden. Vor kurzem ist die „Erzählung aus dem Off“ – so der Untertitel - im müry salzmann Verlag erschienen. Aus dem Abseits meldet sich ein junger Mann zu Wort, der nach einem von ihm mitverschuldeten Unfall, bei dem eine Person schwer verletzt wurde, zu Hausarrest mit Fußfessel verurteilt wird. Ein Zustand, den der von Frau und Kind verlassene Bildhauer, der allerdings schon lange keine Aufträge mehr annimmt, freiwillig aufrechterhält.
„Man kann weder tun, was man will, noch wollen, was man will. Da lebt es sich wesentlich widerspruchsfreier.“ Der auf sich selbst zurückgeworfene Icherzähler bewundert die Vögel in seinem Garten als „Koryphäen des Nichtstuns“, er erlebt eine „weitestgehende Wunschlosigkeit“, leidet an „sensorischen Irritationen“ und wird in der Nacht, die allein von Rattengescharre am Dachboden gestört wird, zum „Silbenklauer, zum Wortepflücker“.
In drei großen Kapiteln entfaltet Christoph Linher das lange Selbstgespräch eines jungen Mannes, der sich selbst verloren gegangen ist und mehr oder weniger verzweifelt versucht, anhand von Erinnerungsbruchstücken etwas über sich in Erfahrung zu bringen. Doch auch ihnen, diesen „Erinnerungsfallstricken“ traut er nicht mehr, und eigentlich erinnert er sich nur, um zu vergessen. „In der Erwartung: immer noch in der Hoffnung, dass der Erinnerungsfarn unter meiner Gedankenflut irgendwann ersäuft.“
Aus ihrem Lächeln gefallen
Auf einer griechischen Insel versucht der Icherzähler, aus der eigenen Erinnerung zu flüchten, doch auch sie entpuppt sich als „ein Trugschluss“. Die Erinnerungen kommen überfallsartig. Jene an die Großeltern, von denen der junge Mann wenig bis fast gar nichts weiß. „Ihre einzige Gemeinsamkeit war, sie teilten nichts, sie teilten sich nichts mit, wobei sich der Großvater mit dem Leben immer zu arrangieren verstand, während meine Großmutter einen Weg suchte, sich nicht mehr arrangieren zu müssen.“ Jene an seine Frau mit ihrer „sehr wesentlichen Art“, die eines Tages „aus ihrem Lächeln gefallen ist“. Jene an seinen Sohn, von dem er nicht mehr so genau weiß, wann er ihn zum letzten Mal gesehen hat. „Es könnte sein, dass ich einmal auf den Wiesenausläufern eines Gebirges gesessen bin, womöglich war mein Sohn bei mir, und ich oder wir haben in die sich auffaltende Landschaft geschaut, unter einem weiten, aber greifbaren Himmel, und vielleicht ist mein Herz unter dem Eindruck einer groß und größer werdenden Ruhe übergegangen, eine Kinderhand auf meinem Knie“. Gegen Ende konstatiert der Icherzähler: „Wenn man erst einmal begriffen hat, dass der Konjunktiv die einzig mögliche Wirklichkeitsform ist, kann sich hinter jeder Tür das Grauen verbergen.“
Notorischer „Langsamschreiber“
Christoph Linher ist ein – wie er selbst sagt – notorischer „Langsamschreiber“. Der einstige Leadsänger und Texter der „Bambirock oder Miesepeterpop“-Band „Any major dude“ feilt lange an seinen Sätzen, an deren Klang. Er ist Teil jener Autorengeneration, die dem linearen Erzählen zutiefst misstraut und die Satzkomposition der Handlungskonstruktion voranstellt. „An eine Geschichte zu glauben, Kausalitäten, Zwangsläufigkeit…das ist nichts als Fatalismus“, lässt er seinen Icherzähler an einer Stelle des Buches sagen. Dieser empfindet sich selbst als sprachlos. „Und nie habe ich verstehen können, warum die Worte sich mir widersetzen, am Gaumen festsitzen wie Polypen an einem Tiefseeriff.“ Dieser Sprachlosigkeit des Erzählers begegnet der Autor mit einer überzeugenden Sprachkompetenz und -opulenz; Einer manchmal geradezu überbordenden Freude an Wortneuschöpfungen („Geschichtsfeld“, „Allnachtsphantasien“, „Kalauerflor“), poetischen Satzkaskaden und am assoziativen Mäandern, das die Orientierungslosigkeit des einsamen Icherzählers zusätzlich verstärkt. „Im Grunde möchte ich von nichts mehr was wissen. Möchte ein unbeschriebenes Blatt sein. Sehne mich zurück nach Erkenntnisdesinteresse. Gedankenlosigkeit. Kindsein.“
Christoph Linher, Farn, 112 Seiten, Gebunden mit Schutzumschlag, € 19,-, ISBN 978-3-99014-130-4, Müry Salzmann Verlag