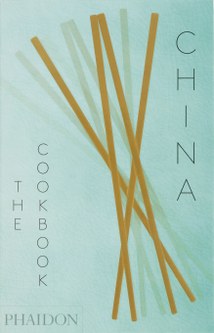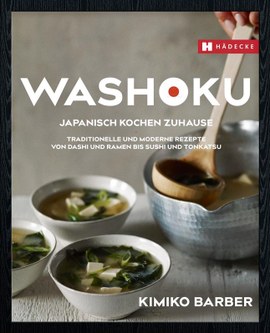Bücher für die Küche - Ein kleiner Streifzug
Auch heuer sind wieder eine Reihe interessanter Kochbücher erschienen.
Immer noch erscheinen umfangreiche Kochbücher für die gesamte italienische Küche, aber einige Verleger (oder Autoren?) haben eingesehen, dass man auch in einem dicken Buch höchstens eine Regionalküche einigermaßen erschöpfend behandeln kann. Dort ist es auch sinnvoll, die Dinge beim lokalen Namen – also im Dialekt – zu nennen und Warenkundliches über Nischenprodukte anzuführen. Ein gelungenes Beispiel dafür ist das bei Phaidon erschienene Kochbuch Neapel und die Amalfiküste mit seinen vier Kapiteln Neapel, Caserta, Salerno und die Amalfiküste, Avellino und Benevento. In den warenkundlichen Zwischentexten findet man das Caserta-Schwein (eine alte, streng lokale Rasse) und die Friarelli (ein Verwandter des Rübstiels) ebenso wie Präzisierungen hinsichtlich der Zitronensorten (z. B. Ovale di Sorrento) oder der San-Marzano-Tomate (unter deren Namen auch in Österreich gezüchtete Paradeiser verkauft werden). Und wer weiß schon, dass Neapel nicht nur die Heimat der Pizza, sondern auch ein Zentrum für den aus Frankreich stammenden Baba-Kuchen ist? Typisch für Kampanien sind auch der Limoncello-Likör, der Cacciocavallo-Käse und die vielen Rezepte für Baccalà. Das Buch enthält, wie heute üblich, ganzseitige Landschaftsfotos, auf die ich in diesem Zusammenhang gut verzichten könnte, ist aber insgesamt ein ausgesprochen solides und brauchbares Kochbuch.
Dasselbe lässt sich über das ebenfalls bei Phaidon verlegte Kochbuch mit dem schlichten Titel China sagen. Wie beim Neapel-Kochbuch sind auch hier keine Autorennamen angegeben (bzw. nur eine kleine Liste hinten im Impressum), weil es sich bei beiden um Gemeinschaftswerke handelt. „China“ ist ein Buch, bei dessen Durchblättern ich mir gedacht habe, jetzt könnte ich meine Sammlung von chinesischen Kochbüchern größtenteils weggeben, hier sind alle Rezepte versammelt, die dort verstreut sind, und noch ein paar darüber hinaus, zum Beispiel eines für Schweinedarm, das ich seit langem gesucht habe. Manche gehen auch mehr ins Detail als üblich, so ist bei dem für Quallensalat geschildert, wie man eine ganze Qualle zerlegt. Das ist interessant, auch wenn getrocknete Qualle seit vielen Jahren vorgeschnitten verkauft wird; in einem chinesischen Supermarkt in Wien habe ich allerdings auch einmal ganze Quallen bekommen. In einigen Details lässt dieses aus dem Englischen übersetzte Buch Fragen offen: Etwa, wie die Zutat „Fischbauch vom Graskarpfen“ in mehreren Rezepten definiert ist, ob man den ganzen Lachskopf aus dem gleichnamigen Rezept verzehrt, und wenn es beim „Doppelt gekochten Pökelschinken“ heißt, man solle Jin Hua oder Smithfield-Schinken nehmen, hätte ich mir eine Schinkensorte gewünscht, die ich besser kenne als diesen Smithfield. Aber nichtsdestoweniger: Wenn Sie nur ein China-Kochbuch haben wollen, nehmen Sie dieses.
Nach der Schwarte nun die Petitesse, der Cicchettario von Alessandra de Respinis, in der deutschen Übersetzung erschienen in der Dieterich’schen Verlagsbuchhandlung, Mainz. Alessandra de Respinis ist die Seniorchefin des „Bottegon“ in Fondamenta Nani 992, Dorsoduro, Venedig, und die Erfinderin der „modernen“ Cicchetti, jener raffinierten Appetithäppchen, die man im bàcaro im Stehen zur ombra isst, dem Glas Wein als Aperitif. Früher war ein Cicchetto einfach nur ein Stückchen Brot mit Stockfischcrème oder einer Wurstscheibe und einer Olive, aber Alessandra hat sich einiges einfallen lassen, seit sie 1970 im „Bottegon“, dem Lokal ihres Schwiegervaters, zu arbeiten anfing. Im „Cicchettario“, Untertitel: „Die legendären Rezepte des Al Bottegon in Venedig“, stellt sie „vor allem von mir selbst erfundene cicchetti wie die mit Thunfischtartar und Kakao, Erdbeere und Robiola, Gorgonzola und Marmelade aus grünen Tomaten oder Eigelb und Blütenblättern“ vor. „Mein erstes Experiment war die Weißbrotscheibe mit Thunfisch und Lauch, es folgte die Brotscheibe mit Gorgonzola und Walnüssen, dann die mit Ricotta, Walnüssen und Johannisbeeren, und so ging es weiter und weiter, bis es schließlich siebzig verschiedene Spezialitäten waren.“ Amüsant ist eine Diskrepanz zwischen dem geschwollenen Nachwort des Schriftstellers Hanns-Josef Ortheil, in dem vom „Dreiklang“ der „Urstruktur“ des Cicchetto die Rede ist, der in „Schwingungen“ gerät, worauf sich „Seitenpfade und vitale Nachbarschaften“ auftun, und den lakonischen Bemerkungen Alessandras in vielen Rezepten, dass man dies oder jenes fertig kaufen soll, wenn man es nicht selbst machen kann oder will, zum Beispiel Gemüsepürees, Oktopuscarpaccio oder schwarze Olivenpaste, und der Verwendung von Ketchup als Farbtupfer auf einigen Cicchetti. Dass man den Ketchup oder die Mayonnaise unbedingt selbst machen muss, verlangt sie nirgends, und auch das Brot muss man nicht selber backen.
Tim Spectors Buch Mythos Diät (Berlin Verlag) hätte ich ohne Kenntnis des Untertitels „Was wir wirklich über gesunde Ernährung wissen“ sicher ignoriert. Das Thema „Diät“ interessiert mich nicht, weil es ein alter Hut ist, dass Diäten eher schädlich als gesund sind. Aber ein Buch gegen die modernen Gesundheitsmythen, wie es das Wort „wirklich“ im Untertitel verspricht, ist von allgemeinem Interesse. Tim Spector ist Arzt und Professor für Genetische Epidemiologie am Londoner King’s College, Direktor der Abteilung für Zwillingsforschung am St. Thomas’ Hospital und Leiter des British Gut Project zur Erforschung der Darmflora. Sein Buch ist über die volle Länge nicht ganz so „lebendig und spannend“, wie es der Klappentext verspricht, weil Spector bei manchen Themen sehr ins Detail geht – für Laien manchmal zu sehr – , seine Aussagen sind dafür aber immer von soliden Fakten untermauert. Und wenn es manchmal kompliziert wird (die Stoffwechselprozesse des Menschen sind nun einmal viel komplexere Vorgänge, als man früher angenommen hat), kann man sich am Grundgedanken von Spectors Plädoyer orientieren: Diäten (oder auch nur für allgemein gültig angesehene Essensregeln) funktionieren nicht, weil jeder Mensch auf das gleiche Essen unterschiedlich reagiert. In Spectors Resümee heißt es: „Jeder Körper reagiert unterschiedlich auf alles – angefangen bei der Ernährung über körperliche Aktivität bis hin zur Umwelt, und diese Varianten wirken sich darauf aus, wie viel Fett wir einlagern, wie viel Gewicht wir zulegen und welche Speisen wir bevorzugen. Wie wir herausgefunden haben, sind die Variationen teils auf unsere Gene, aber auch auf die unterschiedlichen Mikroorganismen zurückzuführen, die unseren Darm besiedeln. Bestimmte Gruppen und Arten stehen mit dem individuellen Schutz vor vielen Krankheiten und vor Gewichtszunahme in Verbindung, während andere die Anfälligkeit für diese Faktoren erhöhen.“ Was Spector für unstrittig hält: „Jede Kost mit hohem Gehalt an Zucker und industriell hergestellten Lebensmitteln ist unseren Mikroorganismen und damit unserer Gesundheit abträglich; Ernährungsweisen mit vielen Gemüsen und Früchten sind für beides vorteilhaft.“ Und Spector zitiert zustimmend Michael Pollans „simple Botschaft aus sieben Wörtern“: „Iss Lebensmittel, vorwiegend Pflanzen, nicht zu viel.“
Vom Allgemeinen noch einmal zum Besonderen, zu zwei sehr verschiedenen Büchern über die japanische Küche: Washoku von Kimiko Barber bei Hädecke und Einfachheit von Malte Härtig bei Königshausen und Neumann. Das Titelwort „Washoku“ besteht aus zwei Schriftzeichen, „wa“, alles Japanische, und „shoku“, Essen. Der Untertitel ist „Japanisch kochen zuhause“ und das Buch hält, was es verspricht, diese Rezepte sind ausführbar, ohne dass man dabei das Gefühl hat, man könne mit den japanischen Ansprüchen an das Essen eh nicht mithalten. Allerdings würde ich keine Japaner zum Essen einladen, weil dann unweigerlich dieses Gefühl wiederkäme, auch wenn man alles nach Barbers Vorschlägen gemacht hat. Vor allem, wenn man „Einfachheit“ gelesen hat, laut Untertitel „eine kulturphilosophische Untersuchung der japanischen Kaiseki-Küche“. Kaiseki ist eine Menü-Form, die aus der Teezeremonie hervorgegangen ist. „Der Gedanke des Kaiseki ist, nach Murata, eine Jahreszeit zu essen. Wie isst man den Frühling? Essen ist hier nicht nur ein geschmackliches Phänomen, sondern ein Prozess einer kulturellen Bestimmung von Dingen an einem bestimmten Ort zu einer bestimmten Zeit. Es geht wesentlich um ein Jetzt, in dem Kauen (Handeln), Wahrnehmen und Denken zusammenfallen. Deshalb geht es im Kaiseki nicht um Genuss wie in der europäischen Küche, sondern um eine kontemplative Haltung zu den Dingen. Sie besteht in einer gewissen Distanz zum Essen und macht ein spezifisches Essen im Jetzt durch ein Zusammenfallen von kategorialen Grenzen möglich.“ Wenn Sie gerne das Wasser im Munde zusammenrinnen lassen möchten, lesen Sie „Einfachheit“ nicht. Wenn Sie gerne die Produktion ihrer Gedanken anregen möchten, lesen Sie dieses Buch, es wird Ihnen viel dazu einfallen.