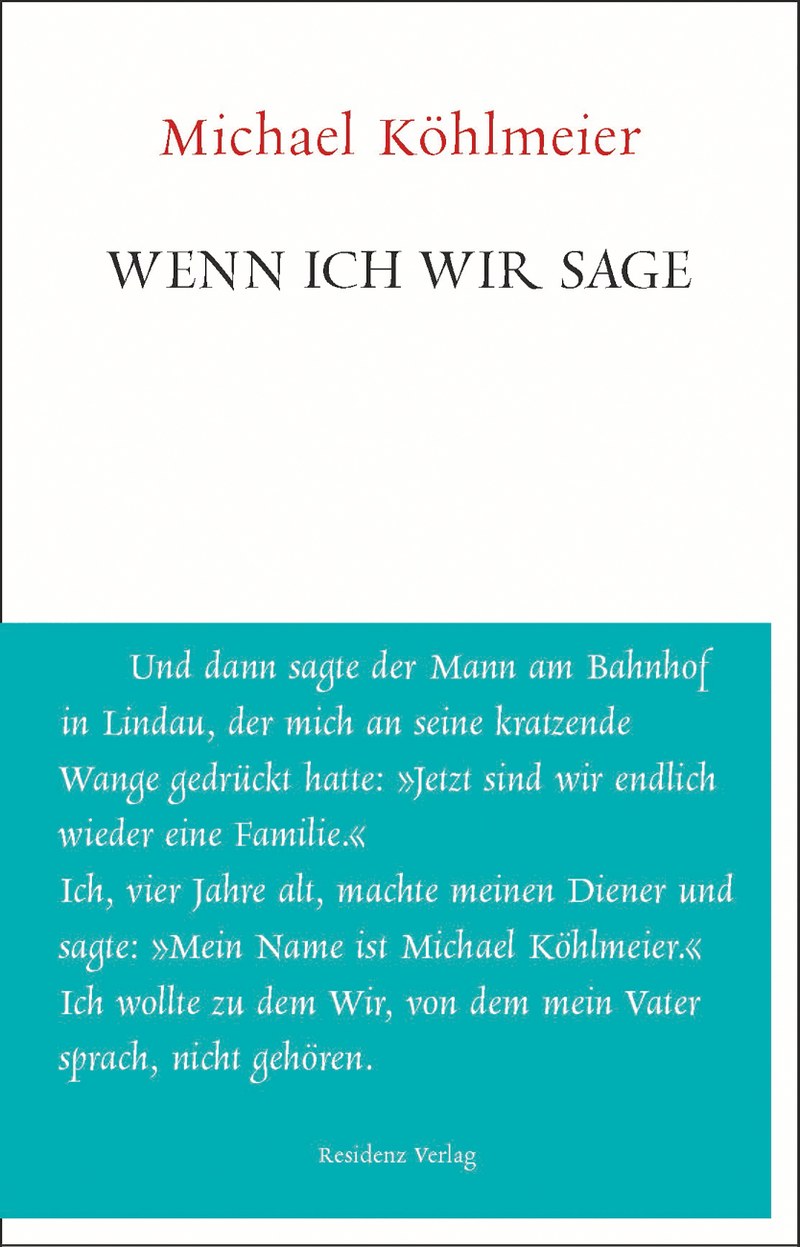Wer denkt „normal“?
Neuauflage von Michael Köhlmeiers „Wenn ich wir sage“
Ingrid Bertel ·
Sep 2023 · Literatur
Der Residenz Verlag hat Michael Köhlmeiers 2019 erstmals erschienenen Essay „Wenn ich wir sage“ neu aufgelegt. Aus gutem Grund, denn Köhlmeier widmet sich darin einem Thema, mit dem wahlkampfbedingt gerade populistisches Kleingeld gewechselt wird.
Als Bundespräsident Alexander van der Bellen bei der Eröffnung der Bregenzer Festspiele davor warnte, den politischen Diskurs auf die gefährliche Ebene eines manichäischen „normal“ vs. „abnormal“ entgleiten zu lassen und dem „wir“ die „anderen“ gegenüberzustellen, da dauerte es keine 24 Stunden, bis die niederösterreichische Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner mit dem rhetorischen Vorschlaghammer ausholte, um die leise Stimme der Vernunft zum Schweigen zu bringen. In einem APA-Interview definierte sie, was sie für „normal“ halte und was im Gegensatz dazu für „radikal“: „Ich meine damit die radikalen Klimakleber, die gerade jetzt im Sommer den Urlaubern das Leben schwer machen. Ich meine Marxisten, ,Reichsbürger‘ und Verschwörungsfanatiker, die immer lauter und radikaler werden.“
Wer denkt abstrakt?
So erzeugt man Feindbilder. „Abstraktes Denken“ nannte der Philosoph Georg Wilhelm Friedrich Hegel im Vorwort zu seiner „Phänomenologie des Geistes“ diese schlichte Einteilung in schwarz und weiß, gut und böse, normal und deppert. Abstrakt nannte er den radikalen Verzicht auf Zwischentöne und Farben. Die Wahrheit, so Hegel, ist aber nicht abstrakt, sondern konkret.
„Wir“ können Liebende sagen, Freunde oder auch die Mitglieder einer Familie. Wer sonst noch? Es gebe da ein „wir“, das ihm durchaus nicht behage, bekennt Michael Köhlmeier: „Ich liebe mein Vaterland nicht, weil ich kein Vaterland habe. Was bitte hat Österreich mit meinem Vater zu tun?“
Die Verschiebung von Gefühlen auf eine Metapher – und eine solche ist der Begriff „Vaterland“ – habe etwas Halunkenhaftes, schreibt Köhlmeier. „Die Nationalisten, die Patrioten, wie sie sich gern nennen, die, die das Vaterland lieben, marschieren auf und befehlen mir ein Wir, indem sie die Wärme, die dieses Wort ausstrahlt, semantisch umleiten und in ein Konstrukt blasen, das mit den Regungen meines Herzens nichts, aber auch gar nichts zu tun hat.“
Das freundschaftliche „Wir“
Wie aber entsteht ein „Wir“? Michael Köhlmeier bittet seine philosophischen Freunde herbei: Ralph Waldo Emerson, Michel de Montaigne und Sokrates, wobei er zu Sokrates ein zwar respektvolles, aber distanziertes Verhältnis pflegt, „weil er hinterhältig ist.“
Sokrates spiele zwar den Fragenden, wisse aber alle Antworten schon im Voraus: „Unsere Teilnahme am Dialog hatte keinen Sinn, sondern einen Zweck. Nämlich den Zweck, die vorgefasste Antwort des Sokrates zu bestätigen, indem wir durch unsere Zustimmung mithalfen, Glied für Glied die Kette seiner Argumentation zu schmieden.“ Auf diese Art und Weise, landen wir zwangsläufig bei den „Normaldenkenden“, „vorausgesetzt wir haben alle Tassen im Schrank und behaupten nicht, dass die Sonne am Morgen im Westen aufgeht und die Erde eine Scheibe ist.“
Wie steht es mit Ralph Waldo Emerson? Er serviere Antworten, stellt Köhlmeier fest. „Die Fragen soll der Leser stellen.“ Der brauche dazu allerdings ein offenes Herz und hat, „wenn er sich auf ihn einlässt, ein großes Leseabenteuer vor sich, und vielleicht wird er – wie ich – einen Freund gewinnen.“
Der Charme der Freundschaft
Allerdings keinen besonders charmanten Freund, womit Köhlmeier bei einem seiner Lieblingsthemen landet – der Differenz zwischen Charme und Charisma, die er etwa in seinem Roman „Matou“ so genussvoll ausbreitet. Und mit dem Begriff Charme ist er in seinem Essay auch bei Michel de Montaigne angelangt.
Montaigne hat den Essay ja überhaupt erst erfunden. 107 Essays hat er geschrieben und behauptete in keinem davon und zu keinem einzigen Thema, er kenne die Wahrheit. Bei ihm schrumpfen „die sogenannten Wahrheiten zu Meinungen“, erkennt Köhlmeier. Montaigne gehe es nicht um die Wahrheit, sondern um den Menschen. Er „ist manchmal verwirrt – wie wir es sind. Er tut nie so, als ob, er führt uns nicht an der Nase herum, er manipuliert uns nicht. Er definiert nicht unsere Schwäche, er zeigt uns die seine.“
Der Boden der Humanität
Welches „Wir“ meint Köhlmeier, wenn er Montaigne liest? Er kommt zu einem Schluss, der für eine offene, demokratische Gesellschaft fundamental ist: Montaignes „Wir“ kennt keine Norm, unterscheidet nicht zwischen „normal Denkenden“ und anderen. „Das Wir ist ein Vexierbild, das so schnell, wie das Wort ausgesprochen ist, von objektiv zu subjektiv und wieder zurückhüpft. Ein Nachdenken über das Wir wird, wenn es ehrlich und ergiebig sein will, immer ein Mäandern bleiben.“
Dieses „Wir“ bietet einen festen Boden an Humanität. Doch auch ein fester Boden kann beben, Risse tun sich auf. „Wir haben nicht vergessen, wie einer von ihnen (den Politikern, die Feindbilder schaffen, Anmerkung I.B.) bei einer Wahlkundgebung mit einem Neonkreuz fuchtelte und kasuistisch zwischen dem Nächsten und dem Übernächsten differenzierte, Ersterer gehöre zum Wir, Letzterer nicht. Immerhin wurde dieser Politiker irgendwann Vizekanzler und sein Einflüsterer, der sich diese Spitzfindigkeit ausgedacht hatte, Innenminister. Und die Kumpanei endete in einem Desaster.“
Dieser Artikel ist bereits in der Print-Ausgabe der KULTUR September 2023 erschienen.
Michael Köhlmeier: Wenn ich wir sage. Residenz Verlag, Salzburg 2019, Neuauflage 2023, 96 Seiten, Klappenbroschur, ISBN 9783701734849, € 20